Elektrischer Betrieb
Facility Management: Elektrische Sicherheit » Handbuch » Betreiberpflichten » Elektrischer Betrieb
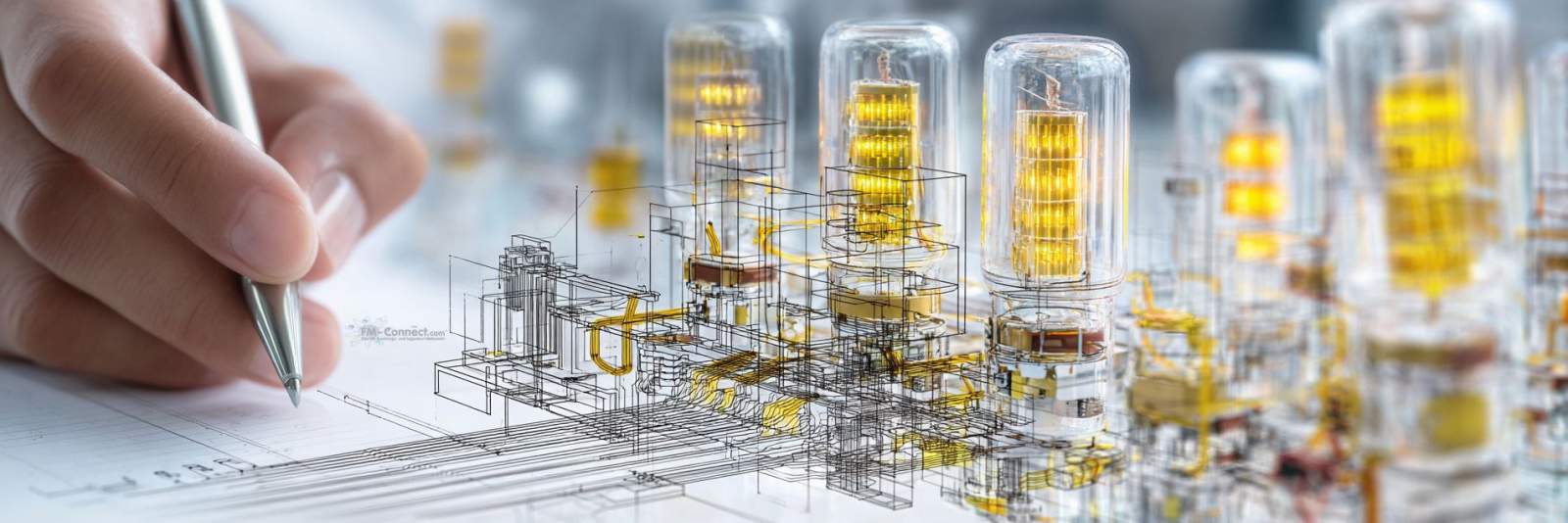
Elektrischer Betrieb– Organisation, Prüfungen, Arbeitssicherheit, Dokumentation
Dieses Dokument konkretisiert die Pflichten des Auftragnehmers als Betreiber der elektrischen Anlagen gemäß den relevanten gesetzlichen und normativen Vorgaben. Grundlage sind insbesondere die DGUV-Vorschriften 3 und 4 (Elektrische Anlagen und Betriebsmittel), die DGUV-Regel 103-011 (AuS-Verfahren), die DGUV-Information 203-071 (wiederkehrende Prüfungen), DIN-VDE-Normen (u. a. VDE 0100-600, VDE 0105-1, VDE 0105-100, VDE 1000-10) sowie die VdS-Richtlinien 2046 und 2871. Ziele sind der betriebssichere, rechtskonforme Betrieb nach Stand der Technik, die Minimierung von Gefährdungen bei Arbeiten an und in der Nähe elektrischer Anlagen, eine lückenlose Prüforganisation mit Prüfbuch sowie ein wirksames Mängel- und Eskalationsmanagement. Im Folgenden werden organisationale Verantwortlichkeiten, Arbeitsabläufe, Prüfpflichten und Sicherheitsanforderungen verbindlich festgelegt.
Vertraglich ist die vollständige, frist- und normenkonforme Leistungserbringung durch fachlich geeignete Elektrofachkräfte (EFK) zu vereinbaren. Dazu gehören u. a. die Organisation der Elektrofachkräfte, die lückenlose Prüfung der Anlagen (inklusive Prüfbuchführung), das Abstellen von Mängeln und ein systematisches Eskalationsmanagement. Alle Abweichungen von Vorschriften werden sofort durch geeignete Maßnahmen behoben. Die Nachweise über durchgeführte Prüfungen, Freigaben und Mängelbeseitigungen sind prüfsicher im CAFM bzw. Archiv vorzuhalten und auf Verlangen vorzulegen. Eine regelmäßige Dokumentation und Berichterstattung sichert die Nachvollziehbarkeit und Einhaltung der Betreiberpflichten auf dem aktuellen Stand der Technik.
- Rechts
- Verantwortlichkeiten
- Betriebs
- Prüfpflichten
- Herstellung
- Arbeiten
- Gefährdungsbeurteilung
- Betriebsdurchführung
- Prüfverfahren
- Wiederholungsprüfung
- Versicherungsrechtliche
- Prüfbuch
- Mängelmanagement
- Unterweisung
- Reporting
- Vertragsanhänge
Rechts- und Normenmatrix (verbindliche Grundlage)- In Tabelle sind die maßgeblichen Regelwerke mit ihren Kernpflichten und Anwendungsbereichen zusammengefasst. Sie bilden die verpflichtende Grundlage für Betrieb und Instandhaltung der elektrischen An
| Kategorie | Regelwerk | Kürzel | Verpflichtung (Kernaussage) | Geltungsbereich |
|---|---|---|---|---|
| DGUV-Vorschrift | DGUV-V 3 | KL1 | Instandhaltung nur durch Elektrofachkräfte (EFK) bzw. unter deren Leitung/Aufsicht; Betrieb nach elektrotechnischen Regeln sicherstellen; Mängel unverzüglich beheben, dringende Mängel außer Betrieb nehmen. | Alle elektrischen Anlagen und Betriebsmittel |
| DGUV-Vorschrift | DGUV-V 3 | KL1 | Elektrische Anlagen müssen sich in sicherem Zustand befinden; Nutzung nur zulässig bei Einhaltung betrieblicher/örtlicher Sicherheitsanforderungen. | Alle Anlagen und Betriebsmittel |
| DGUV-Vorschrift | DGUV-V 3 | KL1 | Erstprüfungen vor Inbetriebnahme und nach Änderungen; Wiederkehrende Prüfungen in festgelegten Intervallen; Prüfungen nach elektrotechnischen Regeln; Führung eines Prüfbuchs auf Verlangen der Unfallversicherungsträger. | Betriebsmittel, Schutz- und Hilfsmittel |
| DGUV-Vorschrift | DGUV-V 3 | KL1 | Vor und während Arbeiten an elektrischen Anlagen spannungsfreier Zustand herstellen und sichern; Arbeiten in Nähe aktiver Teile nur mit Schutzmaßnahmen. | Arbeitsbereiche elektrischer Anlagen |
| DGUV-Regel | DGUV-R 103-011 | KL2 | Arbeiten unter Spannung (AuS) nur nach festgelegtem Verfahren, mit geeigneten Personen, Freigaben, Unterweisung, Stop-Work-Recht. Abstimmung mit Anlagenverantwortlichem über Art/Ort/Zeit, Freigabe durch Arbeitsverantwortlichen nach Einweisung. | AuS-Prozess bei komplexen Arbeiten |
| DGUV-Information | DGUV-I 203-071 | KL3 | Vor Prüfungen: Gefährdungsbeurteilung mit Schutzmaßnahmen; klare Prüf- und Arbeitsanweisungen; Zutrittskontrolle; Einweisung ortsfremder Prüfpersonen; Sicherstellung von Rettungskette bei Alleinarbeit; Bereitstellung erforderlicher Prüfmittel/PSA; Dokumentation und Auswertung der Ergebnisse; Festlegung von Prüffristen im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung. | Prüf- und Prüfmittelmanagement |
| DGUV-Vorschrift | DGUV-V 4 | KL1 | Gleichlautende Pflichten wie DGUV-V 3 im Bereich öffentlicher Einrichtungen. | Öffentliche Einrichtungen |
| DIN/VDE | DIN VDE 0100-600 (Errichten, Teil 6) | KL2 | Erstprüfung vor Inbetriebnahme (Erstprüfung) gemäß Norm. | Errichtung neuer Anlagen |
| DIN/VDE | DIN VDE 0105-1 (Betrieb von Anlagen) | KL2 | Risikobewertung, Arbeitsweise, Notfall, Prüfungen & Dokumentation definieren. | Betrieb/Instandhaltung |
| DIN/VDE | DIN VDE 0105-100 (Wiederkehrende Prüf.) | KL2 | Organisation des Betriebs, wiederkehrende Prüfungen, alternative Überwachung. | Betrieb/Prüfung |
| DIN/VDE | DIN VDE 1000-10 (Berufliche Qualifikation) | KL2 | Bestellung einer verantwortlichen Elektrofachkraft (vEFK). | Organisation Elektrofachkräfte |
| VdS | VdS 2046 / VdS 2871 (Elektrikprüfungen) | KL4 | Regelmäßige Prüfungen nach Versicherungsklausel SK 3602 durch anerkannte Sachverständige; fristgerechte Mängelbeseitigung. | Brandschutzrelevante Anlagen |
Rollen, Verantwortlichkeiten, Bestellung
Der Auftragnehmer stellt eine Struktur sicher, in der alle genannten Rollen klar definiert sind. Die Betreibergesellschaft benennt eine verantwortliche Elektrofachkraft (vEFK) für die fachliche Leitung und Aufsicht. Jede elektrische Anlage erhält einen Anlagenverantwortlichen, dem die unmittelbare Verantwortung für den sicheren Betrieb der Anlage übertragen wird. Vor Beginn von Arbeiten ist zudem ein Arbeitsverantwortlicher zu benennen, der die Durchführung verantwortet. Untergeordnete Fachkräfte (Elektrofachkräfte, Elektrotechnisch unterwiesene Personen) dürfen nur mit entsprechender Qualifikation eingesetzt werden. Personen ohne ausreichende Erfahrung arbeiten ausschließlich unter Aufsicht. Qualifikation, Befugnisse und Vertreterregelungen für alle Rollen sind schriftlich festzuhalten.
Die folgende RACI-Matrix zeigt beispielhaft die Zuordnung von Zuständigkeiten für zentrale Aufgaben:- RACI-Matrix Organisation
| Aufgabe | Betreiber/ Auftraggeber | vEFK | Anlagenverantwortlicher | Arbeitsverantwortlicher | EFK/EuP (ausführend) |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrosicherheits-Organisation | A | R | C | C | I |
| Prüfmanagement (Fristen/GBU/Prüfbuch) | A | R | C | C | R |
| Arbeitsvorbereitung/-freigabe | I | C | A | R | R |
| Mängelmanagement/Eskalation | A | R | R | C | C |
Betriebs- und Instandhaltungsorganisation
Der Auftragnehmer sichert zu, dass Betrieb und Instandhaltung der elektrischen Anlagen ausschließlich nach den anerkannten elektrotechnischen Regeln erfolgen. Elektrotechnische Arbeiten dürfen nur durch Elektrofachkräfte oder unter deren Leitung/Aufsicht ausgeführt werden. Alle Maßnahmen und Änderungen an der Anlage erfolgen nach VDE-Normen. Festgestellte Mängel an Anlagen und Betriebsmitteln sind umgehend zu beseitigen. Bei einer unzulässigen Gefährdungslage sind gefährdete Betriebsmittel sofort stillzulegen und gegen Wiedereinschalten zu sichern. Liegen keine speziellen Vorschriften vor, stellt der Auftragnehmer anhand einer Gefährdungsbeurteilung einen sicheren Zustand her und ergänzt erforderliche Schutzmaßnahmen. Die Nutzung der Anlagen ist nur gestattet, wenn betriebliche und örtliche Sicherheitsanforderungen (z. B. zündschutztechnische oder Umgebungsbedingungen) eingehalten sind.
Prüfpflichten und Prüfbuch
Vor Inbetriebnahme, nach Änderungen sowie in regelmäßigen Abständen müssen Prüfungen durchgeführt werden. Vor der ersten Inbetriebnahme (Erstprüfung) und nach jeder Änderung oder Instandsetzung wird eine Prüfung durch eine Elektrofachkraft oder einen zugelassenen Prüfer durchgeführt. Auch Schutz- und Hilfsmittel unterliegen Prüfpflichten. Wiederkehrende Prüfungen erfolgen in festgelegten Intervallen (beispielsweise unter Risiko- und GBU-Aspekten). Alternativ kann bei ortsfesten Anlagen eine ständige Überwachung durch eine EFK eingerichtet werden. Alle Prüfungen richten sich nach den geltenden Vorschriften (z. B. DIN VDE 0100-600, VDE 0105-100) und dokumentieren sicherheitsrelevante Messergebnisse und Befunde. Die Ergebnisse jeder Prüfung werden im Prüfbuch festgehalten und der Nachweis ist bei Aufforderung den Unfallversicherungsträgern vorzulegen. Zusätzlich fordert die DGUV-Information 203-071 vor jeder Prüfserie eine umfassende Gefährdungsbeurteilung der Prüftätigkeit. Darin sind Gefahren zu ermitteln, geeignete Schutzmaßnahmen zu definieren und den Prüfpersonen jeweils verbindliche Anweisungen zu erteilen. Ohne eine solche Gefährdungsbeurteilung darf die Prüfung nicht durchgeführt werden.
Tabellen 3 und 4 geben einen Überblick über Prüfarten, Auslöser, Prüfer und Nachweise sowie beispielhafte Fristenpläne.- Prüfarten, Auslöser und Nachweise
| Prüfart | Auslöser/Anlass | Regelreferenz | Durchführende | Nachweis |
|---|---|---|---|---|
| Erstprüfung | Neuerrichtung/Erweiterung | DIN VDE 0100-600; VDE 0105-1 § 5.5 | EFK oder autorisierter Prüfer | Erstprüfprotokoll |
| Wiederkehrende Prüfung | Frist (risikobasiert) | DGUV-V 3 § 5; VDE 0105-100 § 5.3.3 | EFK | Prüfbericht, Eintrag im Prüfbuch |
| Ständige Überwachung | Alternative zur Fristprüfung | DGUV-V 3/4 Durchf.-Anweisung; VDE 0105-100 | EFK | Nachweise der Überwachung |
| Prüfung nach Änderung/Instandsetzung | Vor Wiederinbetriebnahme | DGUV-V 3 § 5 | EFK | Abnahmeprotokoll |
| Schutz- und Hilfsmittel | Frist/Benutzung | DGUV-V 3 § 5 | EFK | Prüfkennzeichnung/Dokumentation |
Fristensteuerung (Beispielhafte Rasterung nach GBU)
| Anlagentyp | Einflussfaktoren | Richtintervall | Prüfmethoden | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| NS-Hauptverteilungen | Umgebung, Last, Wartungsgüte | 1–3 Jahre | Sichtprüfung, Erproben, Messen | Intervalle nach Gefährdungsbeurteilung anpassen |
| Steckdosenstromkreise | Nutzung, Umgebung | 1–4 Jahre | Messen, Erproben | Selektivitätsprüfungen empfohlen |
| Ortsveränderliche E-Geräte | Beanspruchung, Umgebung | 6–24 Monate | Sichtprüfung, Messen | Kennzeichnung mit Prüfdatum |
| RCD/AFDD/Schutzgeräte | Herstellerangaben, Norm | 6–12 Monate | Funktionsprüfung (Erproben) | Herstellerangaben beachten |
Herstellung des sicheren Arbeitszustands
Vor und während jeglicher Arbeiten an elektrischen Anlagen ist ein spannungsfreier Zustand herzustellen und zu sichern. Der Auftragnehmer legt den Arbeitsbereich eindeutig fest und kennzeichnet ihn, damit Bewegungsfreiheit, ungehinderter Zugang und ausreichende Beleuchtung gegeben sind. Aktive Teile müssen durch Abdeckung oder Abschrankung geschützt sein; Arbeiten in der Nähe aktiver Teile sind nur unter den Bedingungen des spannungsfreien Zustands oder bei festgelegten Schutzabständen zulässig. Nicht-elektrische Gefahren (Brandlasten, Stolperstellen etc.) sind ebenfalls zu beherrschen. Zugänge, Fluchtwege und der Arbeitsraum sind frei zu halten. Aktuelle Schaltpläne und Betriebsanweisungen sind griffbereit.
Arbeiten unter Spannung (AuS) – Prozess und Freigaben
Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen sind nur zulässig, wenn ein formales AuS-Verfahren vorliegt. Dies umfasst Planung, Freigaben und Unterweisung. Vorarbeiten: Die anweisende Elektrofachkraft plant das Verfahren, wählt geeignetes Personal aus und stellt PSA/Werkzeuge bereit. Der Arbeitsverantwortliche stimmt sich vorab mit dem Anlagenverantwortlichen über Art, Ort, Zeitpunkt und mögliche Auswirkungen ab; diese Abstimmung kann mündlich erfolgen. Nach positiver Gefährdungsbewertung und Instruktion der Prüfer erteilt der Anlagenverantwortliche die schriftliche Erlaubnis (Erlaubnisschein). Vor Ort prüft die autorisierte EFK den Anlagenzustand und die Umgebungsbedingungen. Ist die Arbeit sicher ausführbar, erteilt die EFK nach Unterweisung die Freigabe+. Durchführung: Die ausführenden Elektrofachkräfte befolgen strikt die Arbeitsanweisungen. Sollte sich die sichere Durchführung nicht mehr gewährleisten lassen, ist unverzüglich abzubrechen („Stop-Work“-Recht) und der Arbeitsverantwortliche zu informieren. Anschließend legt dieser das weitere Vorgehen fest. Nach Abschluss meldet die EFK den Status dem Anlagenverantwortlichen zurück. In Tabelle 5 ist der typische AuS-Ablauf als Erlaubnisscheinverfahren skizziert.
AuS-Ablauf (Erlaubnisscheinverfahren)
| Phase | Verantwortlich | Mindestinhalt | Nachweis |
|---|---|---|---|
| Planung | EFK (anweisende EFK) | Verfahrensbeschreibung, Personalqualifikation, PSA, Werkzeuge | AuS-Plan |
| Abstimmung & Erlaubnis | Arbeitsverantwortlicher | Art/Ort/Zeit der Arbeiten, Auswirkungen auf Anlage | Erlaubnisschein |
| Freigabe vor Ort | EFK | Bewertung Anlagenzustand, Unterweisung der Beteiligten | Freigabevermerk |
| Durchführung | EFK/Arbeitskräfte | Einhaltung der Anweisungen, Stop-Work-Befugnis | Tätigkeitsprotokoll |
| Abschluss | EFK → Anlagenverantwortlicher | Information über Status, Übergabe eventueller Restmängel | Abschlussvermerk |
Gefährdungsbeurteilung, Anweisungen, Zutritt, Rettung
Vor jeder Prüf- oder Wartungsmaßnahme muss der Auftragnehmer eine Gefährdungsbeurteilung erstellen. Dabei sind alle möglichen Gefährdungen der Prüftätigkeit zu ermitteln und notwendige Schutzmaßnahmen (z. B. Abschrankungen, Schutzeinrichtungen) festzulegen. Die Prüfpersonen erhalten klare Arbeitsanweisungen, die auf Arbeitsplatz und verwendete Betriebsmittel zugeschnitten sind. Ohne eine solche Gefährdungsbeurteilung darf keine Prüfung beginnen. Unbefugte sind während der Prüfungen fernzuhalten; abgeschlossene elektrische Betriebsstätten dürfen nur von Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen betreten werden. Wird Fremdfirmenpersonal eingesetzt, sind diese in die örtlichen Betriebsregeln und Gefahren einzuweisen. Alleinarbeitende Prüfer arbeiten nur mit gesicherter Rettungskette (z. B. Kommunikationsmittel oder Alarmsystem). Der Auftragnehmer stellt ausreichende Prüfgeräte, persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Werkzeuge zur Verfügung. Ergebnisse werden dokumentiert und ausgewertet. Prüffristen und organisatorische Abläufe werden im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung festgelegt und laufend überprüft.
Betriebsdurchführung, Unterweisung, Kleidung, Notfall
Vor jedem Bedien- oder Arbeitsschritt bewertet das eingesetzte Personal die elektrischen Risiken. Ist die sichere Durchführung nicht mehr gewährleistet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und unverzüglich dem Vorgesetzten bzw. Anlagenbetreiber gefährliche Mängel zu melden und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Elektrofachkräfte tragen stets geeignete Schutzkleidung und PSA gemäß den Anforderungen (isolierendes Schuhwerk, Handschuhe, Schutzbrille etc.). Alle einschlägigen Gesetze, Normen und betrieblichen Anweisungen sind zu beachten. Arbeitskräfte werden mindestens jährlich nach DGUV V 1 zu den elektrischen Gefahren und Schutzmaßnahmen unterwiesen. Überraschende Gefährdungen sind vor Arbeitsbeginn bekanntzugeben. Die Qualifikation der Mitarbeiter (Elektrofachkraft, elektrotechnisch unterwiesene Person) muss der Art und Schwierigkeit der Aufgabe entsprechen. Für elektrische Notfälle (Stromunfälle, Brände) existieren Notfallpläne mit Alarmketten und Wiederbelebungsmaßnahmen. Ausreichend Ersthelfer sowie Erste-Hilfe-Anleitungen für Stromunfälle sind verfügbar. Die Vermeidung von Stromunfällen (Körperdurchströmung, Lichtbogen) hat oberste Priorität.
Prüfverfahren und Dokumentation
Prüfungen dienen dem Nachweis der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und Errichtungsnormen. Bei allen Prüfungen werden Schaltpläne und technische Unterlagen herangezogen. Nach Erstinbetriebnahme (Erstprüfung) nach DIN VDE 0100-600 bestätigt die Fachkraft, dass die Normvorgaben und der Stand der Technik eingehalten wurden. Wiederkehrende Prüfungen umfassen Besichtigen (Sichtprüfung), Erproben (Funktionskontrolle) und Messen (Leiter- und Schleifenwiderstände, RCD-Zeiten usw.). Die Prüfhäufigkeiten werden anhand von Anlagenart, Umgebungsbedingungen, Belastung und bisherigem Befund festgelegt. Gefährliche Mängel sind sofort zu beseitigen; betroffene Teile werden außer Betrieb genommen und gegen Wiedereinschalten gesperrt. Alle Prüfergebnisse einschließlich gefundener Mängel und Abstellmaßnahmen sind zu dokumentieren (Prüfbericht, Foto, Prüfbuch). Die Dokumentation der Maßnahmen und ihrer Wirksamkeit erfolgt im CAFM-System und in den Betriebsunterlagen. In Tabelle 6 sind die typischen Prüfschritte des Prüfprogramms zusammengefasst.
Prüfprogramm – modularer Aufbau
| Modul | Inhalt | Ergebnis |
|---|---|---|
| Sichtprüfung | Überprüfung von Beschriftungen, Leitungsführung, Gehäuse, IP-Schutz, Brandlast | Protokoll „Sicht“ |
| Erproben | Funktionsprüfungen von RCD/AFDD, Verriegelungen, Not-Aus u. Ä. | Protokoll „Funktion“ |
| Messen | Durchgängigkeit von PE und Potenzialausgleich, Isolations-/Schleifenimpedanz, RCD-Ansprechzeiten | Messprotokolle |
| Dokumentations-Check | Überprüfung von Plänen, Beschriftung, Prüfbuch, Maßnahmen-Register | Checkliste |
Alternative zur Wiederholungsprüfung: Ständige Überwachung
Für ortsfeste Anlagen kann die turnusmäßige Wiederholungsprüfung durch eine permanente Überwachung ersetzt werden. Voraussetzung ist eine dokumentierte Gefährdungsbeurteilung der Anlage. Die ständige Überwachung erfordert, dass Elektrofachkräfte kontinuierlich Instandhaltungs- und Überwachungsmaßnahmen durchführen (z. B. Isolationsüberwachungssysteme, regelmäßige Sensorchecks). Es müssen definierte Grenzwerte und Alarme vorgegeben sowie alle Ergebnisse protokolliert werden. Bei Abweichungen ist ein festgelegtes Eskalationsverfahren einzuleiten. Umfang und Verfahren der Überwachung sind im Prüfplan bzw. Prüfbuch festzuhalten.
Versicherungsrechtliche Zusatzprüfungen
Sofern vertraglich gefordert oder durch Versicherungsbedingungen vorgeschrieben, werden regelmäßige Brandschutzprüfungen nach Versicherungsklausel SK 3602 durchgeführt. Eine solche VdS-Prüfung erfolgt in der Regel jährlich durch einen von der VdS anerkannten Sachverständigen. Der Sachverständige prüft dabei alle relevanten elektrischen Anlagen und dokumentiert die Befunde in einem standardisierten VdS-Prüfprotokoll (Befundschein VdS 2229). Festgestellte Mängel werden mit konkreten Fristen zur Behebung vorgelegt. Der Auftragnehmer sorgt für eine fristgerechte Nachbesserung und stellt dem Versicherer die Erledigungsnachweise zur Verfügung.
Prüfbuch, Kennzeichnung, CAFM/GLT-Integration
Der Auftragnehmer führt ein Prüfbuch mit allen vorgeschriebenen Eintragungen zu Prüfarten, Terminen, Ergebnissen und festgestellten Mängeln. Jedes Betriebsmittel und jeder Stromkreis erhält eine eindeutige Kennzeichnung mit Prüfeinträgen oder Prüfsiegeln. Alle Prüf- und Wartungsdaten werden im CAFM-System dokumentiert, so dass Soll-/Ist- sowie Zustandsdaten jederzeit abrufbar sind. Schnittstellen zur Gebäudeleit- und Automatisierungstechnik (GLT/GA) stellen sicher, dass relevante Betriebsdaten (Betriebsstunden, Alarme, Schaltzustände) in Echtzeit verfügbar sind. Über ein digitales Maßnahmenregister werden Mängelbehebungen lückenlos nachverfolgt.
| Nachweis | Quelle | Mindestinhalt | Ablage |
|---|---|---|---|
| Prüfbuch | DGUV-V 3/4 | Geräte/Anlagenbezeichnung, Datum, Prüfer, Ergebnis, Maßnahmen | CAFM-Archiv |
| Prüfbericht (Messprotokoll) | VDE 0105-1/ -100 | Prüfmethode, Messwerte, Bewertung, Restmängel | Technische Akte |
| AuS-Erlaubnisschein | DGUV-R 103-011 | Plan, Abstimmung, Freigabe, Abschlussdokumentation | Arbeitsschein |
| GBU-Dokumentation | DGUV-I 203-071 | Gefährdungen, Schutzmaßnahmen, Prüfmittelliste, Fristen | HSE-Akte (CAFM) |
| VdS-Prüfung | VdS 2046/2871 (SK 3602) | Befundbericht, Behebungsfristen | Versicherungsakte |
Mängelmanagement, Eskalation, Außerbetriebnahme
Liegt ein Mangel mit unmittelbarer Gefahr vor, stellt der Auftragnehmer den Betrieb des betroffenen Anlagenteils unverzüglich ein, sichert das Teil gegen Wiedereinschalten und veranlasst sofort Abhilfemaßnahmen. Alle anderen Mängel werden nach Priorität klassifiziert und innerhalb festgelegter Fristen behoben. Üblicherweise erfolgt die Meldung über ein Eskalationsschema: Hochprioritäre Schäden meldet der Prüfer umgehend an den Arbeits- und Anlagenverantwortlichen sowie an die vEFK; bei Mängeln mit Versicherungsrelevanz wird parallel der VdS-Prozess initiiert. Mittelfristige Mängel werden an vEFK berichtet, Kleinigkeiten an die Instandhaltungsleitung. Der Bearbeitungsstand wird in einem Maßnahmenregister dokumentiert. Tabelle 8 gibt ein Beispiel für Eskalationsstufen mit Fristen.
| Klasse | Beispiel | Maßnahme | Frist | Eskalation |
|---|---|---|---|---|
| Hoch | Isolationsfehler an HV-Sammelschiene | Sofortige Außerbetriebnahme, Abschalten, Sperrung | sofort / 24–72 h | Anlagen-/vEFK, ggf. Behörde |
| Mittel | Fehlende Beschriftung, Planabweichung | Nachbesserung, Dokumentationsanpassung | ≤ 14 Tage | vEFK (und Betreiber) |
| Niedrig | Fehlendes Prüfkennzeichen | Kennzeichnung aktualisieren | ≤ 5 Tage | FM-Leitung |
Unterweisung, PSA, Kleidung, Zugang
Alle an den Arbeiten beteiligten Personen werden zu Beginn und in regelmäßigen Abständen hinsichtlich Sicherheitsanforderungen, maßgeblicher Vorschriften und betrieblichen Arbeitsanweisungen unterwiesen. Diese Unterweisungen erfolgen schriftlich oder mündlich mit Dokumentation. Geeignete Schutzkleidung und PSA (z. B. isolierende Handschuhe, Schutzhelm, Schutzbrille, Flamm-/lichtbogengeschützte Kleidung) sind zwingend zu tragen. Der Zutritt zu elektrischen Betriebsstätten ist geregelt: Elektroräume und Schaltanlagen dürfen nur von Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen betreten werden. Unbefugte sind aus Sperrbereichen auszuschließen. Bei Alleinarbeit ist das Vorhalten technischer (z. B. Funkgeräte, Notsignal) oder organisatorischer Rettungseinrichtungen Pflicht.
Reporting und KPI-Steuerung (Compliance & Betrieb)
Der Auftragnehmer berichtet regelmäßig über die Leistungserfüllung im elektrischen Anlagenbereich. Hierzu werden Kennzahlen (KPIs) erfasst und ausgewertet. Beispiele für KPIs sind: fristgerecht durchgeführte Prüfungen (Soll ≥ 98 %), fristgemäß abgeschlossene Mängelbeseitigungen (z. B. 100 % innerhalb 72 h für kritische Mängel), Einhaltung der AuS-Verfahrensregeln (100 %) und Konformität mit VdS-Anforderungen (100 %). Bei Zielabweichungen werden Ursachen analysiert und Gegenmaßnahmen (Zusatzkontrollen, Schulungen, Nachjustierungen) eingeleitet. Das Reporting erfolgt monatlich bzw. quartalsweise und wird Teil der betrieblichen Besprechungen.
Vertragsanhänge (verbindliche Muster/Pläne)- Es wird vereinbart, dass folgende Anlagen Bestandteil dieses Vertrags sind:
A1: Organisationsplan Elektrik (Stellen, Rollen, Vertreter)
A2: Prüfbuch-Vorlage (inkl. Prüfetiketten-Legende)
A3: Muster Erlaubnisschein AuS (DGUV-R 103-011)
A4: Gefährdungsbeurteilungs-Template (DGUV-I 203-071)
A5: Prüfprogramm-Checklisten (nach VDE 0100-600, VDE 0105-1/-100)
A6: Maßnahmen- und Eskalationsregister mit Fristenmatrix
A7: VdS-SK 3602 Prüfangaben und Mängelverfolgungsvordruck
A8: KPI-Reporting-Vorlage (Monats- und Quartalsbericht)
